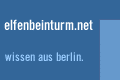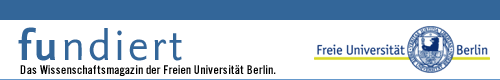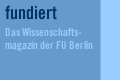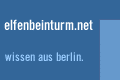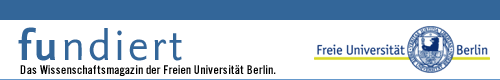| Foto: photocase
Lust und Angst am Schreibtisch
Friedrich Schiller und Franz Kafka - zwei Modelle literarischer Arbeit
Von Peter-André Alt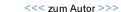
Die Individualität des Schriftstellers bestehe darin, verriet Franz Kafka seinem Verleger Kurt Wolff im August 1912, auf welche Weise er seine literarischen Schwächen zu verbergen suche. Zu den geheim gehaltenen Formen solcher Individualität gehört auch die Arbeitsweise, die einen wichtigen Aufschluss über das spezifische Rollenverständnis eines Schriftstellers, sein Verhältnis zur Sprache, zum Alltag und zu seiner sozialen Umwelt zulässt. Im Umgang mit dem Schreiben treten höchst unterschiedliche Modelle und Verfahrenstechniken zutage, deren einzige Gemeinsamkeit darin liegt, dass die meisten Autorinnen und Autoren ihre Arbeit nur in räumlicher Abgeschiedenheit verrichten können. Tempo und Organisation der Arbeit jedoch gehorchen ganz unterschiedlichen Konzepten, Impulsen und Gesetzen.
Einige Schriftsteller strukturieren ihren Schreiballtag minuziös, bis ins letzte Detail der Zeiteinteilung, der Quantifizierung des zu leistenden Pensums und der Disposition der Manuskripte. Thomas Mann, der bürgerlichste unter den Autoren der Moderne, liefert für diesen Typus das prominente Beispiel. Andere – wie Lessing, Goethe und Heine – folgen den Linien eher impulsiver Schreibzyklen. Hier erscheinen Elemente von Planung und Organisation, die jedoch im Prozess der Arbeit überlagert und vergessen werden können. Schließlich begegnet man dem krampfhaft schreibenden Autor, der in Phasen gesteigerter Produktivität ohne große Unterbrechungen arbeitet, danach aber unter Störungen, Stockungen und Schreibkrisen leidet. Ein Beispiel für diesen Typus repräsentiert Wolfgang Koeppen, der seine drei großen Romane in nur sechs Jahren, zwischen 1948 und 1954, abschloss, in den folgenden vier Jahrzehnten aber keines seiner epischen Großprojekte mehr beendete. Erst in den letzten Jahren hat die Literaturwissenschaft die Möglichkeiten angemessen zu nutzen verstanden, die sich aus einer genauen Analyse individueller schriftstellerischer Produktionsformen ergeben – aus einer Erforschung literarischer Biographien, die keine Untersuchung intimer Enthüllungen anstrebt, sondern Einsichten in die intellektuelle Ökonomie, unter deren Gesetzen ein literarisches Œuvre entsteht.
In jungen Jahren unterwarf sich der Autor Schiller keinen festen Arbeitszeiten. Der Militärarzt führte nach Abschluss des Medizinstudiums in Stuttgart ein Leben als Bohemien. Nach durchzechten Nächten stand er spät auf, verrichtete seinen Dienst in der Krankenstube seines Regiments und begann erst am Abend mit dem Schreiben. So entstanden 1781 und 1782 unter „unordentlichen“ Bedingungen zwei Dramen: Die Verschwörung des Fiesko zu Genua und Kabale und Liebe. Als Schiller aus Stuttgart in das ruhige Exil flieht, wird er zum Morgenmenschen, der zuweilen schon um 5 Uhr früh am Schreibtisch sitzt. In Mannheim arbeitet er zwischen 1784 und 1785 als Theaterdichter und kehrt zum alten Rhythmus zurück, schläft lange, besucht tagsüber die Theaterproben, isst mit den Schauspielern und verbringt seine Zeit mit ihnen beim Wein. Häufig kehrt er erst nach Mitternacht an seine Manuskripte zurück. In den Dresdner Jahren wiederum, von 1785 bis 1787, lebt er wie ein Biedermann, verbringt die Vor- und Nachmittage am Schreibtisch und nutzt den Abend für das gesellige Gespräch oder den Theater- und Konzertbesuch. Entscheidend sind schon für den jungen Autor die äußeren Arbeitsverhältnisse: Auf die besondere Qualität von Tinte, Federn und Papier legt Schiller, wie er seinem späteren Schwager Reinwald verrät, größten Wert. Dass ihn der Geruch überreifer Äpfel, die er in der Schublade verwahrt, stimuliert haben soll, wird von Goethe gegenüber Eckermann am 7. Oktober 1827 berichtet.
 |
In jungen Jahren war Schiller noch ein Lebemann. Gemälde von Christian Xeller
Foto: Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen |
Zu den Aufputschmitteln, die seine Schreiblust fördern, gehören starker Kaffee, Tabak, Likör und gelegentlich ungarischer Wein, den er während der nächtlichen Arbeit zur Anregung getrunken hat. Erst in seiner Wahlheimat Weimar wird Schiller 1787 zum disziplinierten Leistungsethiker. Seine großen historischen Studien, die ästhetischen Essays, später die Geschichtsvorlesungen, die er als außerordentlicher Professor in Jena (ab 1789) zu halten hat, nötigen ihm ein gewaltiges Arbeitspensum auf.
Zum Alltag zählen von jetzt an auch das gründliche Quellenstudium und die strategische Organisation der literarischen Projekte. Die großen Geschichtsdramen der letzten Lebensperiode – vom Wallenstein (1800) bis zum Wilhelm Tell (1804) – entstehen nach einem festgelegten Plan, im Zeichen einer exakten Ökonomie, die nichts dem Zufall überlässt. In der ersten Arbeitsphase treibt Schiller jeweils historische Studien und fixiert seine Lektüreeindrücke in Exzerpten. Danach werden Grundrisse des Handlungsplans, Personenlisten und Gruppen von Leitmotiven zusammengestellt. Die Korrespondenz mit dem Freund Christian Gottfried Körner in Dresden und das kritische Werkstattgespräch mit Goethe und Humboldt begleiten den eigentlichen Prozess der Niederschrift. Schiller ist ein dialogisch orientierter Autor, der den Austausch über seine aktuellen Vorhaben sucht. Noch ehe er sein Manuskript beendet hat, wird in Weimar für gewöhnlich mit den Proben der ersten Szenen begonnen – die Uraufführung seiner großen Dramen erfolgt oft nur wenige Wochen nach ihrem Abschluss in der Handschrift. Mit dem Verleger Cotta werden die Konditionen für die Buchausgabe festgelegt. Auch hier überlässt Schiller nichts dem Zufall, und er mischt sich mit großer Sachkenntnis in den Herstellungsprozess ein: In aller Gründlichkeit debattiert er mit Cotta über Satztypen, Seitenschnitt, Titelvignetten und Auflagenzahlen. Die Produktion gehorcht ebenfalls einem exakten Planungsdenken, bei dem sich während Schillers letzter Lebensjahre Geschäftssinn und Gespür für den literarischen Markt verbinden.
Charakteristisch für Schillers künstlerisches Selbstverständnis bleibt der kritische Blick auf früher Geleistetes. Trotz Goethes nachdrücklicher Bitte gibt er in den knapp zehn Jahren der gemeinsamen Tätigkeit für das Weimarer Theater seine Jugenddramen nicht mehr für eine Aufführung frei. Anfang September 1794, in der Phase der ersten Sondierung des Wallensteinstoffs, erklärt er, „ein Machwerk“ wie der Don Karlos „ekele“ ihn längst an. Zwei Jahre nach Abschluss der Wallenstein-Trilogie betont er, dass er beim aktuellen Stand seiner Selbsteinschätzung den heiklen Stoff nicht mehr in Angriff genommen hätte. Über die Maria Stuart vermerkt er im Oktober 1801, ein halbes Jahr nach der Buchpublikation, dass sie die stoffliche Plastizität vermissen lasse, die das Publikum zu Recht erwarte. Resigniert kündigt er nach dem Abschluss der Braut von Messina im April 1803 an, er werde einen ähnlichen „Wettstreit mit den alten Tragikern“ nicht nochmals versuchen, weil er sich in seinen Bemühungen um eine objektive Kunstform allzu isoliert fühle. Solche Äußerungen bezeugen einen sehr genauen und nachdenklichen Umgang mit den Themen der eigenen Arbeit – und den Drang, immer wieder neue Wege einzuschlagen, um lähmende Wiederholungen und die Erstarrung in Routine zu vermeiden. Im Mai 1801 schreibt er Körner in einem Brief, dass ihm die „Wahl eines Gegenstands“ für die dramatische Bearbeitung zunehmend schwerer falle, weil „der Leichtsinn“ fehle, mit dem er früher ein Thema ausgewählt habe.
Das Vergnügen an neuen künstlerischen Herausforderungen schließt für Schiller die intensive Beschäftigung mit abgeschlossenen Arbeiten aus. In der Schublade seines Schreibtischs verwahrt er zwar Listen noch unvollendeter Projekte, selten jedoch die Manuskripte älterer Texte. Das entspricht dem Prinzip der ständig fortschreitenden intellektuellen Aktivität, wie es Goethe und Humboldt als Merkmal seiner künstlerischen Ökonomie hervorgehoben haben.
Mit zunehmender Intensität steigert sich Schiller nach 1800 während der ihm noch verbleibenden fünf Lebensjahre in einen regelrechten Arbeitsrausch, der umso bemerkenswerter ist, als er durch Krankheitsschübe, vor allem Bauchkrämpfe, Brustentzündungen und Nervenfieber, regelmäßig zu tage- und wochenlangen Schreibpausen genötigt wird. Immer deutlicher erkennt er, dass Phasen der Ruhe und Entspannung für ihn nicht notwendig Erholung bedeuten, sondern allein die intellektuelle Agilität jenen eingeschränkten Lebensgenuss ermöglicht, der auch die physischen Übel in Grenzen hält. Bereits im Januar 1796 bemerkt der Rittmeister von Funck nach einem Besuch in Jena gegenüber Körner: „Man sieht, in welcher ununterbrochenen Spannung er lebt und wie sehr der Geist bei ihm den Körper tyrannisiert, weil jeder Moment geistiger Erschlaffung bei ihm körperliche Krankheit hervorbringt.“ Im Februar 1801 erklärt Schiller gegenüber Christiane von Wurmb, dass man versuchen müsse, „jeden Augenblick mit voller Kraft zu ergreifen, ihn so zu benutzen, als wäre es der einzige letzte.“
 |
Schillers Schreibtisch enthielt Listen unvollendeter Projekte, selten die älteren Texte
Foto: Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen
|
Nach der dreijährigen Arbeit am Wallenstein, der, Anfang 1799 vollendet, im Sommer 1800 beim Verleger Cotta vorliegt, entstehen die großen Dramen der letzten Lebensperiode wie unter dem Bewusstsein des bald bevorstehenden Todes: Maria Stuart in zwölf Monaten, die Jungfrau von Orleans in neun, die Braut von Messina in fünf, der umfangreichere Wilhelm Tell in sechs Monaten. Zu welchen Leistungen Schiller imstande ist, wenn ihn seine Krankheit nicht behindert, zeigt das Tempo, in dem er kleinere dramatische Arbeiten wie Die Huldigung der Künste abschließt: Für das immerhin 250 Verse umfassende Spiel benötigt er im November 1804 lediglich fünf Tage. Um seine Kräfte für die großen Projekte zu schonen, befasst er sich seit Mitte der 1790er Jahre in Perioden angeschlagener Gesundheit bevorzugt mit Bühnenbearbeitungen und Übersetzungen. Auch solche Gelegenheitsschriften werden jedoch meist innerhalb kurzer Zeit beendet. Die Erstellung einer Bühnenfassung von Goethes Egmont dauert im April 1796 trotz schlechter körperlicher Verfassung nur zwei Wochen, Lessings Nathan redigiert er für die Bedürfnisse des Weimarer Theaters im April 1801 in einigen Tagen, die Übersetzung von Racines Phèdre ist wenige Monate vor seinem Tod, beeinträchtigt durch Krankheitsschübe, in nur vier Wochen abgeschlossen. Hinter solchen Kraftakten steht ein protestantisches Arbeitsethos, das Schiller weit über die Grenze des gesundheitlich Verantwortbaren führt. „Die Hauptsache ist der Fleiß“, schreibt er am 15. November 1802 an Körner, „denn dieser giebt nicht nur die Mittel des Lebens, sondern er giebt ihm auch seinen alleinigen Werth.“
Ein völlig anderer Arbeitsstil zeichnet Franz Kafka aus. Die als quälend empfundene Tätigkeit des Versicherungsjuristen hält den Beamten Kafka von 8 bis 14 Uhr im Büro der Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt fest. Es war eine Stelle mit „halber Frequenz“, die Kafka nach dem 1906 abgelegten juristischen Examen gezielt ausgesucht hatte, weil er sich im Alltag genügend Raum zum Schreiben bewahren wollte.
Neben der knapp bemessenen Zeit gab es andere Widerstände, die ihn von der literarischen Arbeit abhalten konnten: Er war extrem geräuschempfindlich und litt unter dem ständigen Lärm, der in der elterlichen Wohnung herrschte (sie blieb mit wenigen Unterbrechungen bis zu seinem Tod 1924 sein Domizil). Es dauerte einige Jahre, ehe Kafka erkannte, dass die Stille der Nachtstunden seinem Ideal des störungsfreien Schreibens unter den herrschenden Umständen die besten Voraussetzungen eröffnete. Erst Ende Dezember 1910 entschließt er sich, den Abend ab 21 Uhr der literarischen Arbeit vorzubehalten. Am Nachmittag schläft er, danach setzt er sich an den Schreibtisch, den er nicht selten erst gegen 2 Uhr in der Frühe verlässt. An Schlaf ist nach den Schreiborgien der Nacht nur selten zu denken. So wird sein „Manöverleben“, wie er es Ende August 1920 in einem Brief an seine Geliebte Milena Pollak nennt, zwar zur Existenzbedingung des Schriftstellers, aber zugleich zur physiologischen Qual. „Träumen ohne zu schlafen“, lautet die im Tagebuch mehrfach wiederholte Formel, mit der Kafka seine durchwachten Nächte charakterisiert.
Seine ideale Arbeitssituation schildert er am 14. Januar 1913 in einem Brief an seine spätere Verlobte Felice Bauer: Er entwirft von sich selbst ein Bild des Höhlenbewohners, der „mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten abgesperrten Kellers“ sitzt, seine Mahlzeiten allein einnimmt, das Tageslicht meidet und gänzlich dem anstrengungslosen, leichten Strom seiner Ideen folgt, wie ihn allein die absolute Versenkung gebiert.
Aus Gustav Roskoffs Geschichte des Teufels (1869) zitiert sein Tagebuch im August 1913 einen Hinweis, dass bei den karibischen Ureinwohnern „der, welcher in der Nacht arbeitet, als der Schöpfer der Welt“ gelte. Das Modell des schreibenden Eremiten, der sich den Forderungen des Lebens entzieht, ist jedoch zahlreichen Gefährdungen ausgesetzt. Nicht nur äußere Faktoren schaffen regelmäßig Grenzen, die Kafkas literarischer Konzentration schaden. Es gehört zur Eigentümlichkeit seiner Produktion, dass sie in Zyklen des Wechsels von Schreibstrom und Unterbrechung verläuft. Den Perioden unerhörten Gelingens mit der kompletten „Öffnung des Leibes und der Seele“ – so die von Kafka selbst verwendeten Formulierungen nach der nächtlichen Entstehung des Urteil im September 1912 – folgt mit mechanischer Konsequenz eine Blockade, die den literarischen Fluss aufhält. „Ein vollständiges Stocken der Arbeit“ ist dann zu konstatieren, und: „Ich bin an der endgiltigen Grenze, vor der ich vielleicht wieder Jahre lang sitzen soll, um dann vielleicht wieder eine neue, wieder unfertig bleibende Geschichte anzufangen.“ (November 1914)
Ein gleichmäßiges Arbeiten über längere Zeiträume bleibt Kafka zeitlebens verwehrt. Die Verteilung der Energien auf überschaubare Tagesabschnitte scheint ihm unmöglich; die extrem ökonomische Lebensorganisation Goethes, Fontanes oder Thomas Manns ist das absolute Gegenstück zu seinen unbeherrschbaren Schreibzyklen. Was literarisch gelingt, glückt allein in plötzlich anbrechenden Phasen äußerster Konzentration. Auch seine längeren Texte schreibt er mit wenigen Ausnahmen zumeist in einem gedrängten Zeitabschnitt nieder, seine großen Perioden literarischer Produktion verlaufen in gänzlich unberechenbaren Zyklen.
Zwischen September 1912 und Februar 1913 schreibt Kafka sich förmlich in einen Rausch. In kaum einem halben Jahr entstehen 500 Seiten: die Erzählungen Das Urteil und Die Verwandlung, der Roman Der Verschollene und zudem fast 180 Briefe an die spätere Verlobte Felice Bauer. Danach stagniert das Schreiben wieder für eineinhalb Jahre, ehe es im Juli 1914 für sechs Monate mit der Niederschrift des Romans Der Process wieder in Gang kommt. Auch später bleibt dieser Rhythmus erhalten: Das Frühjahr 1917 (mit den Erzählungen des Landarzt-Bandes), der Herbst 1920 (mit zahlreichen kleinen Prosastücken) und der ausgehende Winter 1922 (mit dem Schloss-Roman) stellen fruchtbare Phasen dar, während die dazwischen liegenden Perioden von monatelanger Schreibunfähigkeit beherrscht werden.
Kafkas Ideal schriftstellerischer Arbeit entspricht es, in einen Strom der Bilder einzutauchen, um möglichst ohne Steuerung und Planung das, was in seiner Phantasie bereitliegt, als gleichsam sich selbst abspulendes Programm zu aktivieren. Dieser Vorgang besitzt für ihn eine handfeste erotische, ja sexuelle Dimension. Am 3. Oktober 1911 bemerkt er, die kreativen Kräfte in seinem Inneren müssten zum Ausbruch kommen, um sich nicht selbst zu vernichten; darin glichen sie jenen „Ergießungen“, die er in der Pubertät im Verhältnis zu seiner Gouvernante unterdrückte, sodass sie sich „im Rückstoß“ in ihm selbst auflösten. Von „Erhebung“ im Schreibakt ist einen Monat später die Rede. Ins Schreiben hätte er sich „ergießen wollen“, heißt es im Januar 1912 nach einem monotonen Sonntag, an dem ihm die Arbeit misslang. Als sinnlich besetzter Vorgang, der den Körper und die Seele im Medium der Schrift aufgehen lässt, ist das Schreiben für Kafka aber nicht nur eine erotische Erfahrung, sondern auch religiös geprägte Verheißung. Das gelingende Schreiben bedeutet, dass er in einen Stromkreis eintritt, der spirituelle Energie freisetzt. Seinen direkten Ausdruck findet das Wissen über den offenbarenden Charakter der literarischen Produktion in einer Notiz von 1920: „Schreiben als Form des Gebets“. Kafka betrachtet die schriftstellerische Tätigkeit als mystischen Akt, der die Annäherung an ein Absolutum von Sinn und Sinnlichkeit ermöglicht. Zu den Risiken solcher ekstatischer Erlebnisse zählt jedoch der Sturz in die Mühen der Ebene. Die „vollständige Öffnung des Leibes und der Seele“ blieb wie jede mystische Erfahrung begrenzt auf die seltenen Momente eines Glücks, das Kafka nicht herbeizwingen und steuern konnte. Der Leistungsethiker Schiller sieht das Schreiben vergleichsweise nüchterner; seinem Freund Körner gesteht er am 18. Januar 1788: „Ich muss von Schriftstellerei leben, also auf das sehen, was einträgt.“ Formen mystischer Ekstase und spiritueller Offenbarung scheint Schiller am Schreibtisch nicht erlebt zu haben. Bezeichnend, dass er kein Tagebuch führt, sondern nur einen Kalender, in dem er täglich das geleistete Pensum notiert.
Die Individualität des Autors ist in der besonderen Ökonomie seiner Arbeitsweise aufgehoben; diese Hypothese bestätigt sich im Blick auf die vielgestaltigen Formen, denen das literarische Schreiben seit dem Beginn der Neuzeit unterliegen kann. Ob Gebet oder Kalkül, Qual oder Glück, Planung oder Assoziationslust – die literarische Produktion gehorcht unterschiedlichen Rhythmen und Gesetzen. „Die Schrift“, so formuliert es der Philosoph Jacques Derrida, „ist für den Schriftsteller eine notwendige und gnadenlose Schifffahrt.“
|