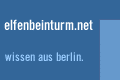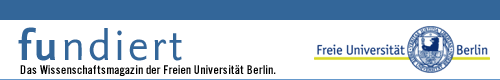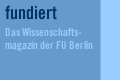| Foto: Wannenmacher
Die Verteilung der Erwerbsarbeit
Historische Erfahrungen und gegenwärtige Probleme
Von Paul Nolte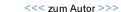
Seit fast drei Jahrzehnten ist millionenfache Arbeitslosigkeit das größte ökonomische und gesellschaftliche Problem in Deutschland: zunächst in der „alten“ Bundesrepublik, nach der Wiedervereinigung erst recht in den neuen Ländern. Dieses Thema bestimmt die politischen Debatten und die öffentlichen Schlagzeilen, aber die Fähigkeit zur Problembearbeitung steht in einem krassen Missverhältnis zur allgegenwärtigen Problembeschwörung. Auf inzwischen längst vorhersehbare Weise wechseln sich immer neue Zyklen der Erwartung und der Enttäuschung ab: Wird der nächste wirtschaftliche Aufschwung, die nächste konjunkturelle Erholung nicht endlich ein spürbares Sinken der Arbeitslosenzahl bewirken? Immer weniger Menschen glauben in Deutschland noch an die Zukunft der Vollerwerbsgesellschaft. Müsste Arbeit nicht anders verteilt werden? Was ist eigentlich der Normalfall, an dem wir unsere Erwartungen von der Erwerbsarbeit messen? Wie hat sich das Verhältnis von Arbeitszeit und Lebenszeit im Industriezeitalter verändert? Es lohnt sich, gegenwärtige Probleme mit historischen Erfahrungen zu konfrontieren.
Der Vollzeiterwerb, dieses Leitbild von Arbeits- und Lebenszeit, das wir heute, grob gesprochen, mit der Fünftagewoche und dem Achtstundentag, mit fachlicher Ausbildung und spezifischer Berufstätigkeit verbinden, war in den vergangenen zwei Jahrhunderten erheblichen Veränderungen unterworfen. In der klassischen Industriegesellschaft galt ein Muster der Verteilung von Arbeitszeit, das nach der Grundregel funktionierte: Je höher der soziale Status, desto geringer und flexibler die Arbeitszeit. Für die Lohnarbeiterschaft, für das industrielle Proletariat, aber auch für Land- oder Heimarbeiter galten extrem lange Arbeitsstunden, mit nicht selten 12 oder 14 Stunden am Tag, an sechs Tagen in der Woche, ohne den Anspruch auf Erholungsurlaub.
 |
Heute kaum mehr vorzustellen, aber 1908 hatten Mitarbeiter des Kaufhauses des Westens Anspruch auf zwei Stunden Mittagspause. Aufnahme aus dem Jahr 1907
Foto: KaDeWe |
In den gesellschaftlichen Führungsschichten, nicht zuletzt im Wirtschaftsbürgertum, ging es, der protestantischen Ethik zum Trotz, lange Zeit etwas behäbiger und ruhiger zu. Morgens erschien man im Kontor, um mittags zu einer ausgedehnten Mahlzeit und einer Ruhestunde bei der Familie zu sein, danach stand noch einmal das Geschäft auf dem Arbeitsplan. Die Geselligkeit, zum Beispiel in den Räumen des bürgerlichen Vereins, kam nicht zu kurz. Gleichzeitig kann man generell sagen, dass die Erwerbsarbeit in allen sozialen Schichten lange Zeit – sicher noch um 1900, auch noch um 1950 – einen größeren Teil des Tages in Anspruch nahm, sie zugleich aber weniger verdichtet war. Man fing morgens früh an und hörte erst abends auf – Pausen und Unterbrechungen waren nicht im Minutentakt angelegt. Für Angestellte im Berliner Kaufhaus des Westens begann die Arbeit im Jahre 1908 um halb neun Uhr morgens und endete um acht Uhr abends, doch darin war außer einer Frühstückspause eine zweistündige Mittagspause eingeschlossen.
Erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts hat die Ausdifferenzierung von Arbeitszeit mit ihrer Standardisierung, Komprimierung und Unterscheidung von der arbeitsfreien Zeit jenen Höhepunkt erreicht, an dem sich unsere kulturellen Maßstäbe und politschen Ziele bis heute häufig orientieren. Dafür waren Impulse der kapitalistischen Rationalisierung (Wem nützen zwei Stunden Mittagspause, in der Kapital brachliegt?) ebenso verantwortlich wie der Kampf der Beschäftigten für eine Verkürzung der Arbeitszeit zugunsten des „Feierabends“. Der Achtstundentag galt dabei schon früh als ein Fluchtpunkt, dessen Überzeugungskraft sich aus der Idee einer vernünftigen Drittelung des Tages ableitete: Acht Stunden arbeiten in körperlicher Anstrengung und fremder Verfügung, acht Stunden schlafen und acht Stunden eigene, selbstbestimmte Zeit: „Eight Hours for What We Will“ lautete deshalb eine Parole der amerikanischen Arbeiterbewegung für den Achtstundentag. In Deutschland galt er als allgemeine Norm seit 1918. Aus Gesichtspunkten der betrieblichen Effizienz war das für die Unternehmer auch deshalb akzeptabel, weil nach ihrer Rechnung drei Achtstundenschichten den Tag vollständig ausfüllten, ohne dass die Produktionsbänder jemals stillzustehen brauchten.
 |
Der Samstag nicht mehr als Teil der Arbeitswoche: eine Gewerkschaftsforderung aus Kindermund
Foto: Archiv des sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Signatur: 6/PLMV000441)
|
Bekanntlich galt dieses Modell zunächst für sechs Tage in der Woche, erst viel später wurde der Samstag davon ausgenommen, als die Gewerkschaften Kinder von Plakaten fordern ließen, „Samstags gehört Vati mir!“
Doch die Zeit, in der die Norm auch Realität war, erscheint aus heutiger Sicht als erstaunlich kurz: Nur ein bis zwei Jahrzehnte später begann die heutige Massenarbeitslosigkeit. Der Kampf um die 35-Stunden-Woche begann und stand weniger unter dem Vorzeichen humaner Arbeitsbedingungen als vielmehr einer gerechten Verteilung der Erwerbsarbeit. Zugleich durchbrach die Flexibilisierung von Arbeitszeit immer häufiger die klassische Formel des „fünf mal acht“ auf der festen täglichen Zeitschiene dessen, was auf Englisch „nine till five“ heißt.
Im ökonomischen Umgang mit der Erwerbsarbeit und der zunehmenden Arbeitslosigkeit setzte sich spätestens zu Beginn der 1980er Jahre weithin die Auffassung durch, dass in einer technologisch hoch entwickelten Gesellschaft, die zugleich ökologisch an die „Grenzen des Wachstums“ stieß, die Menge der vorhandenen Erwerbsarbeit höchstens konstant sei, langfristig aber eher schrumpfen müsse. Die Konsequenz daraus konnte nur sein, das vermeintlich fixe Erwerbsarbeitsvolumen dann wenigstens gerechter zu verteilen, also durch Arbeitszeitverkürzung die Erwerbslosen wieder in den Arbeitsmarkt zu ziehen.
Dass veränderte europäische und globale Wettbewerbsbedingungen die deutsche Wirtschaft und ihre Arbeitsmärkte herausforderten und eine Antwort nötig machten, wurde lange Zeit hinter der Überzeugung verdrängt, Menschen würden deshalb arbeitslos, weil wir so gut, so produktiv, so modern seien – gewissermaßen die weltweiten Pioniere auf dem allgemeinen Marsch in die arbeitsfreie Wohlstandsgesellschaft.
Inzwischen ist leicht erkennbar, dass die Schrumpfungs- und Verteilungstheorie der Erwerbsarbeit einen Sonderweg markiert, der eher tiefer in die Krise der Erwerbsarbeit hineingeführt hat, statt stabilisierend zu wirken. Die Vorstellung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt seien statische Größen, weswegen man die bestehenden Arbeitsplätze um beinahe jeden Preis erhalten müsse – nicht zuletzt um den Preis enormer öffentlicher Subventionen – hat die Fähigkeit zu Innovation und wirtschaftlichem Strukturwandel gehemmt. Das gilt nicht zuletzt für den Wandel der Industriegesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft.
 |
Selbstverständnis der Bundesrepublik und der DDR: Wenn die Schlote rauchten, schienen Wachstum und Produktivität gesichert
Foto: Photocase |
Die Bundesrepublik wie die DDR hatten ihr Selbstverständnis als produzierende Ökonomien gefunden – die Schlote mussten rauchen und die Fließbänder laufen, dann waren Wachstum und Produktivität gesichert. Dem wirtschaftlichen Sinn und dem Produktivitätszuwachs durch hoch spezialisierte Dienstleistungen traute man dagegen nicht so recht. So verfestigte sich eine ökonomische Kultur, deren Leitmotiv die Verwaltung des Bestehenden ist – der bestehenden Unternehmen, der bestehenden Arbeitsplätze, sogar der bestehenden Arbeitslosigkeit. Alle Partner im Konsens-Dreieck von Unternehmen, Gewerkschaften und Politik konnten damit etwa zwei Jahrzehnte lang gut fahren.
Dabei blieb zu lange unbeachtet, dass die Präsenz von Erwerbsarbeit auch durch andere Faktoren, nicht zuletzt durch die demographische Entwicklung und den Wandel von Lebens- und Karriereverläufen, immer stärker gefährdet wurde. Kaum irgendwo sonst ist die Erwerbsarbeitsphase im Lebenszyklus so verkürzt worden wie in Deutschland seit 25 Jahren. Einerseits erfolgt der Eintritt ins Berufsleben hier vergleichsweise spät, zumal mit akademischer Ausbildung, nach der die Phase der Erwerbstätigkeit eher im Alter von 30 Jahren statt fünf Jahre früher wie in vielen anderen Ländern beginnt. Den Arbeitsmarkt hat das aber offensichtlich ebenso wenig nachhaltig entlastet wie das „andere Ende“ des Lebenszyklus’: der immer weiter vorgezogene Ruhestand. Die politisch viel zu lange begünstigte, ja geförderte Aussteuerung von Menschen aus der Erwerbsarbeit im Alter von 58 oder 55 Jahren und teilweise noch früher, die massenhafte Frühpensionierung von Beamten hat die Erwerbsphase insgesamt – etwas überspitzt gesagt – zu einer Zwischenstation des Lebens werden lassen: Auf drei Jahrzehnte Kindheit und Adoleszenz folgen drei Jahrzehnte Erwerbstätigkeit, darauf wiederum drei Jahrzehnte des Ruhestandes.
Der deutliche Anstieg der Lebenserwartung hat diese „Drittelrechnung“ fast schon zur Realität werden lassen. Für die heute Jüngeren, die mit einer Lebenserwartung von 90 Jahren und mehr rechnen können, wird diese Rechnung eine Selbstverständlichkeit sein. Da außerdem wegen des Geburtenrückgangs der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung steigt, schrumpft das Segment der potenziell oder tatsächlich erwerbstätigen Bevölkerung weiter. Wer noch erwerbstätig ist, verfügt in Deutschland, manchen Einschränkungen der letzten Zeit zum Trotz, nach wie vor über eine im internationalen Vergleich besonders niedrige Wochenarbeitszeit und zahlreiche Urlaubstage.
Erst allmählich wird uns bewusst, dass eine solche Entwicklung nicht ohne dramatische Konsequenzen bleiben kann. Das sind keineswegs nur ökonomische Konsequenzen, etwa hinsichtlich der Finanzierung eines Ruhestandes, der genauso lange dauert wie die „Ansparzeit“ der Erwerbsphase. Mindestens ebenso gewichtig sind soziokulturelle Folgen für den Alltag einer Gesellschaft: Erwerbstätigkeit wird zum Minderheitenphänomen, und die Erwerbsarbeit strukturiert nicht mehr typischerweise das Leben oder den größten Teil der Lebenszeit.
Doch wie verhält es sich mit der Flexibilisierung von Erwerbsarbeit und Arbeitszeit, die aus starren Zeitrastern im Tageslauf (morgens bis spätnachmittags), im Wochenrhythmus (montags bis freitags) und sogar im Lebenszyklus (erst Arbeit, dann Ruhestand) hinausführt? Mit Formen der flexibilisierten, entstrukturierten Arbeitszeit tut sich Deutschland nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell vergleichsweise schwer. Die gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Verkürzung, Verlängerung, Verschiebung von Erwerbsarbeitszeiten werden häufig nur oberflächlich diskutiert. Wir hören uns gerne die Klagen über eine Ausweitung der Samstags- und Sonntagsarbeit an und vergessen, dass die „Betroffenen“ damit möglicherweise die Hälfte ihrer wöchentlichen Arbeitszeit absolviert haben, meist nicht einmal zu ungünstigen tariflichen und steuerlichen Bedingungen, und zeitlichen Freiraum anderswo gewinnen. Prekärer und komplizierter sind andere Formen der Flexibilisierung, die sich schon vollzogen haben oder gegenwärtig gerne propagiert werden. Dazu gehört die Idee von Lebensarbeitszeitkonten. Sie sollen eine flexible Schichtung der Lebensarbeitszeit dergestalt ermöglichen, dass sich der Übergang in den Ruhestand gleitend vollzieht, statt mit einem abrupten Ende. In jungen Jahren wird, der körperlichen Leistungsfähigkeit entsprechend, mehr gearbeitet, mit 45 oder 50 reduziert. Das ist ein Modell, das den Historiker auffällig an vor- und frühindustrielle Muster der Verteilung von Lebensarbeitszeit erinnert.
Mit der Realität einer modernen Gesellschaft gerät dieses Muster dagegen in mehrfacher Hinsicht in Konflikt. Erstens verläuft die Kurve körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit inzwischen glücklicherweise ganz anders, sodass es in Verbindung mit dem Wandel von Erwerbstätigkeit kaum einen Grund mehr gibt, warum ein Sechzigjähriger nicht genauso lang arbeiten sollte wie ein Vierzigjähriger – wie gesagt, ist der inzwischen zur Ausnahme gewordene Hochofenarbeiter damit nicht gemeint. Zweitens werden wir uns einen solchen Lebensarbeitsverlauf angesichts der demographischen Entwicklung, bei der die Jüngeren zur Minderheit werden, kaum leisten können. Und drittens schließlich steht dieses Modell der gesamten familien- und gesellschaftspolitischen Diskussion entgegen: Nicht die Fünfzig- oder Sechzigjährigen brauchen dringend zeitlich Spielräume in der Erwerbsarbeit, sondern die Dreißig- und Vierzigjährigen, von denen wir den Mut zur Familiengründung erwarten, die dafür aber auch eine Chance in ihrer Zeitökonomie sehen müssen. Wenn also schon flexibilisieren, sollte es heißen: für Eltern weniger Wochenarbeitszeit und mehr Urlaubstage – in der Lebensphase danach längere Arbeitszeit und ein paar Urlaubstage weniger.
Eine andere Verschiebung von Erwerbsarbeitszeiten hat sich in den letzten Jahrzehnten bereits auf breiter Front vollzogen, ohne dass sie jemals eine breitere Diskussion ausgelöst hätte. Die Rede ist von der stark beschleunigten sozialen Spaltung der Arbeitszeit entlang der Linien der „neuen Klassengesellschaft“. Ganz vereinfacht gesagt, hat sich das oben beschriebene Muster des „Oben wenig, unten viel“-Arbeitens der klassischen bürgerlichen Gesellschaft inzwischen umgekehrt. In den höheren sozialen Schichten, bei den Bestqualifizierten und Gutverdienenden, hat sich Arbeitszeit ausgedehnt – im Tages- und Jahreszyklus wie im Lebensverlauf – in den unteren sozialen Schichten, bei den Geringqualifizierten und Geringverdienern, ist sie verkürzt worden. Das begann, Stichwort 35-Stunden-Woche, als Interessenpolitik. Inzwischen wird niedrigere Arbeitszeit gerne auch gegen den Willen der Betroffenen verordnet. Erwerbsarbeit an sich und der Umfang der Arbeitszeit sind auf diese Weise zum Merkmal sozialer Distinktion geworden.
Wer früh wegfährt und spätabends nach Hause kommt, ist nicht der bemitleidenswert Ausgebeutete wie früher, sondern zeigt seinen Nachbarn den beruflichen Erfolg und den sozialen Status.
 |
Mein Haus, mein Auto, meine Yacht: Beruflicher und sozialer Status sind heute oft an lange Arbeitszeiten gekoppelt
Foto: photocase/pixelquelle |
Dieser eigenartige, zumal in historischer Perspektive verblüffende Trend hält seit mehreren Jahrzehnten an und wird auch durch bewusste politische und unternehmerische Entscheidungen forciert, ohne dass man sich dabei über die kulturellen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen einer solchen Spaltung der Arbeitszeit hinreichend klar zu sein scheint. Dafür lassen sich viele Beispiele der letzten Jahre aus Großunternehmen wie auch aus dem öffentlichen Dienst in Deutschland anführen. Die im November 2003 bei Opel in Rüsselsheim erreichte Arbeitszeitvereinbarung war dafür ein Signal. Angesichts der Absatzprobleme der Autos mit dem Blitz und um Entlassungen zu vermeiden, verzichteten die Mitarbeiter des Unternehmens auf Arbeitszeit und auf einen Teil des Lohnausgleichs. Die Wochenarbeitszeit sank von 35 auf 30 Stunden, bezahlt werden 32,6 Stunden. Doch wohlgemerkt galt dies nur für die Beschäftigten in der Produktion. Die Mitarbeiter in der Verwaltung und in anderen Schreibtischabteilungen bei Opel, die Ingenieure, die Designer, das Management, leisteten ihren „solidarischen Beitrag“ nämlich auf andere, auf die umgekehrte Art und Weise:
Sie willigten in eine verlängerte Arbeitszeit ein (zehn Minuten am Tag oder etwa drei Stunden im Monat), ohne dafür Geld oder Freizeitausgleich zu erhalten. Die 750 Führungskräfte des Unternehmens verzichteten ohne Ausgleich auf zwei Urlaubstage. Sie arbeiten also seitdem mehr, nicht weniger. Ähnliche Vereinbarungen sind bei der Deutschen Telekom und anderen Großunternehmen getroffen worden.
Und auch der Staat nutzt dieses Modell inzwischen für seine Beschäftigten der verschiedenen Kategorien und verstärkt damit soziale Differenzierung entlang der Arbeitszeit. Beamte arbeiten länger, Arbeiter kürzer. An der Hochschule wird – wie etwa im Land Berlin – die Arbeitszeit einer Vollzeitsekretärin auf gut 34 Stunden pro Woche reduziert, während Professoren ein höheres Lehrdeputat erhalten. Die Wirkung ist offensichtlich: Die Schere zwischen denen, die viel arbeiten, und denen, die wenig arbeiten, geht weiter auseinander, und zwar entlang einer Trennlinie zwischen dem gesellschaftlichen „Oben“ und „Unten“, zwischen der Ober- und Mittelschicht der Gesellschaft einerseits, der Arbeiter- und Unterschicht andererseits, zwischen spezialisierten Professionals und Geringqualifizierten. Wer zur „besseren“ Gesellschaft gehören will, kann das bei uns zunehmend dadurch demonstrieren, dass er viel arbeitet und wenig Freizeit hat – in einer Gesellschaft, der angeblich die Arbeit ausgeht. Diese Entwicklung ist gefährlich und weist auf schwere Fehler hin, mindestens auf eine Kurzsichtigkeit der beteiligten Entscheider, ob in der Politik oder in den Unternehmen.
Ökonomisch führt ein solches Modell, das Geringqualifizierte von Erwerbsarbeit freistellt, eher noch tiefer in den Teufelskreis der Verdrängung von Erwerbsarbeit hinein, weil es unproduktive Strukturen konserviert sowie Arbeitsmärkte langfristig entdynamisiert und von Innovationsdruck entlastet. Sozialpolitisch verstärkt es eine Spaltung der Gesellschaft, die sich ohnehin vollzieht, nämlich in der Differenzierung von Einkommen, von Lebenslagen, von Bildungschancen, von kulturellen Stilen, und fügt ihr eine zusätzliche Dimension hinzu. Kulturell und symbolisch forciert diese Spaltung eine weitere Marginalisierung der Erwerbsarbeit in jenen Teilen der Gesellschaft, die ohnehin schon vom Verlust an Erwerbsarbeit am meisten betroffen sind. Die hoch qualifizierte Beschäftigung hebt sich von der niedrig qualifizierten auch in der Zeitökonomie des Alltags, der ein wesentlicher Faktor des Lebensstils und der sozialen Realität einer Gesellschaft ist, deutlicher ab, während die Grenzen zwischen Beschäftigungslosigkeit, marginaler Beschäftigung und niedrig qualifizierter Erwerbsarbeit tendenziell fließend werden. Man könnte noch hinzufügen: Auch geschlechter- und familienpolitisch ist dieses Modell fragwürdig, wenn man an die jetzt so häufig beklagte Kinderlosigkeit der akademischen „Vielarbeiter“ denkt – auch hier gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeit, Zeitökonomie und Lebensstil.
Massenarbeitslosigkeit ist ein viel zu kompliziertes Phänomen, um entweder auf den nächsten Aufschwung zu warten oder von einer Gesellschaft zu träumen, die sich von den „Zwängen“ der Erwerbsarbeit überhaupt befreit hat. Auf vielschichtige Weise sind in den letzten 200 Jahren immer wieder alte Formen von Erwerbsarbeit aufgelöst worden und neue entstanden. Soziale Muster der Verteilung von Arbeit – im Tages- und im Lebenslauf, zwischen den Geschlechtern und zwischen den sozialen Klassen – haben sich verschoben, und die Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte sind ein Teil davon. Die historische Erfahrung lehrt, heute genauer hinzusehen. Vielleicht lehrt sie auch, das Ziel einer erwerbstätigen Gesellschaft nicht vorschnell preiszugeben.
|