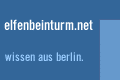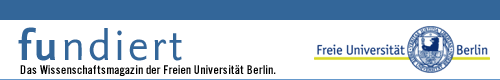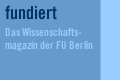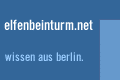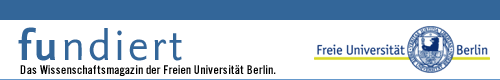Während im Hintergrund eine fröhliche Gesellschaft tafelt, sitzt der Achtzigjährige zwischen den spielenden Kindern und kann sich nur noch am Feuer wärmen.
Kupferstich bei A. van Londerseel nach Maerten de Vos (1531 – 1603)
Bilder: Sammlung Kohli
Die alterne Gesellschaft
von Martin Kohli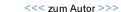
Altern beginnt nach dem bekannten Diktum von Max Bürger schon bei der Geburt. Auch wer das nicht wahrhaben will, kommt gewöhnlich um das Altern nicht herum. Das gesetzliche Rentenalter von 65 erreichen unter den heutigen Sterblichkeitsverhältnissen 84 Prozent der Neugeborenen. Wenn man einen absehbaren weiteren Rückgang der Sterblichkeit einbezieht, werden es sogar 91 Prozent sein.1
Mit dem Begriff der „alternden Gesellschaft“ begeben wir uns jedoch auf eine andere Ebene. Die demographischen Daten sind auch hier bedeutungsvoll, aber sie sind es nicht allein. Dass die Menschen zunehmend länger leben, ist ein wichtiger Befund, aber entscheidend ist, was die Gesellschaft daraus macht. Die Gliederung nach Lebensphasen ist eine der möglichen Dimensionen der Naturalisierung von Gesellschaft. Naturalisierung heißt, dass von Menschen geschaffene gesellschaftliche Ordnungen sich als etwas Natürliches präsentieren, anders gesagt, dass Selbstverständlichkeit durch den Rekurs auf Biologisches gewonnen wird. Andere Formen der Naturalisierung sind Geschlecht oder Verwandtschaft. Dass jede Naturalisierung sich auch auf ein biologisches Element stützt, ist offensichtlich und macht ihre Plausibilität aus (wie am deutlichsten das Beispiel Geschlecht zeigt). Aber es ist nur der Grundstoff für die gesellschaftliche Konstruktion. Dies wird allein schon durch die große Spannweite der gesellschaftlichen Lösungen des Problems der Lebensalter – oder der gesellschaftlichen Nutzung der durch sie gebotenen Möglichkeiten – belegt. Die Art, wie Gesellschaften Lebensalter praktisch und begrifflich gliedern und bestimmte Lebensläufe vorschreiben oder als erstrebenswert definieren, ist außerordentlich vielfältig.
Daraus darf jedoch nicht geschlossen werden, die Gliederung sei jederzeit frei wählbar. Sie muss vielmehr als ein Aspekt der Sozialstruktur insgesamt verstanden werden – und damit als Teil eines Ganzen, das nicht einfach zur Disposition steht. Der strukturelle Grundtatbestand dafür ist die gesellschaftliche Organisation der Arbeit. Wenn wir heute von einer „alternden Gesellschaft“ sprechen, so beziehen wir uns offensichtlich darauf, dass es eine Zäsur zwischen „erwerbstätig“ und „nicht mehr erwerbstätig“ gibt. Denn die chronologische Altersgrenze (60 oder 65 Jahre), die für die Definition einer „alternden Gesellschaft“ meist herangezogen wird, hat – wie die gerontologische Forschung inzwischen in aller wünschbaren Klarheit demonstriert hat – weniger mit biologischen oder psychischen Prozessen zu tun als vielmehr mit der Veränderung in der sozialen Partizipation, die in diesem Alter für den größten Teil der Männer (und zunehmend auch für die Frauen) stattfindet: dem Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand.
In der Frühmoderne war eine Deutung des höheren Alters im Sinne einer Naturalisierung noch eher plausibel als heute. Die Stufen des menschlichen Lebens wurden als natürlicher Auf- und Abstieg dargestellt. Sie waren allerdings nicht als Abbild der Realität gedacht, sondern im Sinne einer moralischen Tugendlehre. Es gab durchaus ältere Menschen, aber es waren relativ wenige. Der Diskurs des Alters räumte ihnen die Rolle als Vorbild der Gelassenheit und Weisheit – frei von den Leidenschaften der Jugend – ein, stellte sie jedoch mit zunehmenden Lebensjahren unerbittlich unter das Signum von Gebrechlichkeit und Verfall. Noch im 19. Jahrhundert wurde das höhere Alter weitgehend mit „Altersschwäche“ identifiziert, und in der Diskussion um das Bismarck’sche Vorhaben einer Invaliditäts- und Altersversicherung wurde die vorgesehene Rentengrenze von 70 Jahren als eine Art natürlicher Invaliditätsgrenze betrachtet. Inzwischen ist dies längst nicht mehr haltbar und wird auch von kaum jemandem noch so gesehen. Die Verselbstständigung der Altersphase und ihre Ausdehnung an beiden Enden – durch den früheren Übergang in den Ruhestand und die längere Lebensdauer – hat dazu geführt, dass sie heute nicht mehr als „Restzeit“ verstanden werden kann, die es irgendwie zu durchleben gilt; sie erfordert vielmehr den Entwurf neuer biographischer Projekte und stellt die Frage nach der Beteiligung am sozialen Leben in neuer Form.
Die Altersgrenzen des Erwerbs- und Rentensystems sind nach wie vor stark verhaltensbestimmend; eine nachhaltige Umkehr des langjährigen Trends zum frühen Ruhestand oder auch nur eine Flexibilisierung des Übergangs in den „Ruhestand“ lässt sich noch kaum beobachten. Aber „alt“ ist man deshalb noch lange nicht. Im Alters-Survey haben wir einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt gefragt, ab welchem Alter man jemanden als alt bezeichnen würde.
Die Antworten zeigen, dass der Beginn des Alters gut zehn Jahre später als der faktische Übergang in den Ruhestand angesetzt wird, nämlich zwischen 70 und 75 Jahren. Die Altersdefinition der Gesellschaftsmitglieder entspricht also in den Grundzügen den Gliederungsvorschlägen in Wissenschaft und Öffentlichkeit, die in der Phase bis etwa 75 Jahren eine neue Lebensphase des „jungen Alters“ sehen. Es scheint sich eine neue Altersgrenze zu konstituieren, die zwar (noch) keine sozialstrukturelle Relevanz hat, wohl aber eine gewisse soziokulturelle und psychologische Zäsur bildet.
Dabei ist mit zunehmendem Alter der Befragten eine leichte Höherstufung zu erkennen; die Differenz zwischen den Mittelwerten der 40 bis 44-Jährigen und der 80 bis 85-Jährigen beträgt rund fünf Jahre. Insgesamt fällt aber doch der erhebliche Konsens zwischen den Altersgruppen auf. Frauen tragen ihrer höheren Lebenserwartung insofern teilweise Rechnung, als sie den Beginn des Alters im Mittel rund zwei Jahre später ansetzen als die Männer.
Sozialwissenschaftliche Alternsforschung in Berlin
„Altern“ hat als Thema der Forschung in Berlin eine lange Tradition. Das mag damit zusammenhängen, dass (West) Berlin schon früher als andere Landesteile mit den Problemen des Alterns der Gesellschaft konfrontiert wurde. Nach dem Mauerbau haben viele Familien mit Kindern die Stadt verlassen, so dass die demographische Alterung schon in den 1970er Jahren noch stärker als in anderen Großstädten spürbar wurde. Bedeutungsvoll sind aber auch wissenschaftsimmanente Gründe. Berlin ist zu einem Zentrum des Lebenslaufansatzes in der Soziologie und Psychologie geworden und auch die Sozialpolitikforschung hat hier einen starken Standort. Neben den Universitäten bestehen heute eine Reihe weiterer Forschungseinrichtungen, die sich mit diesem Themenbereich auseinandersetzen, z. B. das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) oder das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA).
Die wissenschaftliche Spitzenstellung Berlins zeigt sich unter anderem in der Beheimatung großer interdisziplinärer empirischer Studien – insbesondere der Berliner Alters-Studie, die unter der Federführung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung steht und an der auch die FU beteiligt ist, und des Deutschen Alters-Survey, der maßgeblich von der Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL) am Institut für Soziologie der FU konzipiert wurde und jetzt vom Deutschen Zentrum für Altersfragen weitergeführt wird. Innerhalb der FU sind es vor allem die Geschichtswissenschaft, die Psychologie und die Soziologie, in denen das Themenfeld seit vielen Jahren bearbeitet wird und die in diesem Feld internationale Anerkennung gewinnen konnten. Im Bereich der Geschichtswissenschaft ist vor allem Arthur Imhof zu nennen, der die historische Demographie mit aufgebaut und in diesem Zusammenhang eine Reihe erfolgreicher Bücher zur Verlängerung der Lebenszeit publiziert hat. Bei der FU-Psychologie wäre an erster Stelle die leider viel zu jung verstorbene Margret Baltes zu erwähnen, deren Schwerpunkt in der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne lag und die das Graduiertenkolleg „Psychische Potenziale und Grenzen im Alter“ mit begründet hat. In der Soziologie steht die Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf im Vordergrund, in der unter der Leitung von Martin Kohli in den letzten zwei Jahrzehnten eine ganze Reihe von (auch international vergleichenden) Untersuchungen zum Wandel der Lebenslaufstrukturen und Generationenverhältnisse, zu den institutionellen und biographischen Prozessen des Alterns und des Übergangs in den Ruhestand sowie zu den gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen des demographischen Wandels durchgeführt worden sind (nähere Angaben unter www.fall-berlin.de). Derzeit ist die Forschungsgruppe u.a. am großen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) und an einem Projekt der Ford Foundation über die Rolle von Vermögenstransfers zwischen den Generationen beteiligt. Die Zukunft dieser Forschung steht und fällt allerdings mit der noch ungewissen Zukunft der FU-Soziologie insgesamt. |
Wie beziehen sich die Menschen in der zweiten Lebenshälfte auf ihr eigenes Altern? Auch hier ergibt unsere Repräsentativstichprobe ein überraschend einheitliches Bild, das jeder festen Altersgrenze zuwiderläuft, sich aber dennoch klar auf die Chronologie des Lebenslaufs richtet: Die Befragten fühlen sich im Mittel rund 10 Jahre jünger, als sie es ihrem chronologischen Alter nach sind. Die Frauen fühlen sich – mit Ausnahme der ältesten Gruppe – im Schnitt sogar noch etwas jünger als die gleichaltrigen Männer; der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist allerdings geringer als bei der Alterskategorisierung.
Obwohl der Unterschied hier in die gegenteilige Richtung zu gehen scheint, passen die beiden Befunde doch gut zusammen: Frauen betrachten die andern Menschen als jünger (d.h. setzen den Beginn des Alters später an), als Männer dies tun, und fühlen sich auch selber jünger – ein Anzeichen für eine stärkere subjektive Jugendlichkeit.
Angesichts dieser Befunde kann man erwarten, dass die „neuen“ bzw. „jungen Alten“ nicht nur neue Lebensstile des Alters zum Ausdruck bringen, sondern auch neue Aufgaben übernehmen und sich stärker engagieren. Solche Erwartungen bekommen in den aktuellen Debatten um Bürger- oder Zivilgesellschaft, Kommunitarismus und soziales Kapital zusätzliches Gewicht. Mancherorts wird bereits ein zunehmendes Missverhältnis zwischen Leistung und Leistungsfähigkeit der „Ruheständler“ behauptet – besonders zugespitzt im Diskurs über „intergenerationelle Gerechtigkeit“, der seit Mitte der 80er Jahre aus den USA nach Deutschland herübergeschwappt ist. Dabei wird behauptet, die Älteren hätten sich auf Kosten der nachfolgenden Generationen unrechtmäßig bereichert und würden heute vom Wohlfahrtsstaat unverhältnismäßig begünstigt: Der Wohlstand der heutigen Rentner und Pensionäre gehe zu Lasten enormer ökonomischer Folgekosten (Arbeitslosigkeit durch zu hohe Lohnnebenkosten, Kinderarmut) und ökologischer Schäden (hemmungslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, Umweltzerstörung) für die jüngeren Generationen, welche die heute Älteren nie tragen mussten. Letztere würden sich derweil geruhsam in eine sozial abgefederte Konsumentenrolle zurückziehen. Die Wohlfahrtsbilanz über den gesamten Lebenslauf sei somit ungerecht zwischen den Generationen verteilt. In der Bundesrepublik ist diese Argumentation zunächst von der Lifestyle- und Meinungspresse aufgegriffen worden, aber inzwischen auch in der Politik angekommen. Mit dieser Argumentation werden nicht nur die Aufbauleistungen der Älteren und die Entbehrungen, die ihre frühen Jahre prägten, entwertet, sondern es wird auch übersehen, was sie heute noch leisten. Sie sind keinesfalls nur „passive“ Empfänger von familialen oder sozialstaatlichen Hilfen und Transfers, sondern tragen selbst in beträchtlichem Maße produktiv etwas zur Gesellschaft bei.
Dabei ist insbesondere an drei Tätigkeitsformen zu denken: die ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen und Verbänden, die informelle Unterstützung hilfe- und pflegebedürftiger Personen sowie die Betreuung von Enkelkindern (die für die Mütter im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft kritisch ist). Auch wenn diese Tätigkeiten gewöhnlich unbezahlt sind, kann ihr wirtschaftlicher Wert in groben Umrissen abgeschätzt werden. Zählen wir – hier wieder auf der Basis des Alters-Survey von 1996 – die Stunden zusammen, die von den über 59-Jährigen in diesen drei Feldern jährlich geleistet werden, so ergibt sich – hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung zwischen 60 und 85 Jahren – die beeindruckende Zahl von 3,5 Milliarden Stunden. Setzen wir einen Wert von 11,80 Euro pro Stunde an – den durchschnittlichen Netto-Stundenlohn in Organisationen ohne Erwerbscharakter, also Wohlfahrtsverbänden, Parteien usw. –, so ergibt sich ein Gesamtwert von 41,3 Milliarden Euro, den die 60- bis 85-Jährigen in der Bundesrepublik jährlich freiwillig und weitestgehend unentgeltlich erbringen. Das entspricht 21 Prozent des gesamten jährlichen Renten- und Pensionsaufkommens. Diese Größenordnung macht sehr deutlich, dass die Älteren nicht nur konsumieren, sondern auch „produzieren“, und nicht pauschal als Kostgänger des Sozialstaats oder gar als „gierige Grufties“ angeprangert werden dürfen. Für eine Lebensphase, die mit einigem Recht gemeinhin als Ruhestand charakterisiert wird, den man sich durch lange Arbeitsjahre verdient hat, ist das doch erstaunlich hoch; zumal hier nur ein Teil der produktiven Tätigkeiten berücksichtigt wurde und die ökonomische Bewertung längst nicht alle Aspekte des gesellschaftlichen Wertes dieser Tätigkeiten erfasst. Zu denken ist dabei vor allem an gesellschaftliche Integration im Sinne von „sozialem Kitt“, Solidarität und Systemakzeptanz. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben bei der ökonomischen Betrachtung psychologische Aspekte, zum Beispiel der Sinnerfüllung im Alter. Auf der andern Seite kann man natürlich bedauern, dass diejenigen, die sich in einem dieser drei Bereiche engagieren, in der Minderheit bleiben und ihr Anteil über die Altersgruppen hinweg abnimmt. Die Potenziale sind in dieser Hinsicht also sicher noch nicht ausgeschöpft.

Mit 60 kann man noch Lehrer und Vorbild sein.
Kupferstich von Christian Lindemann nach Johann David Hertz (Augsburg, ca 1740)
Das Altern der Gesellschaft hat auch das familiale Generationenverhältnis verändert. Durch die zunehmende Lebenserwartung, den zeitweiligen Rückgang des Generationenabstandes und die sinkende Fertilität ist es zu einer starken „Vertikalisierung“ der Familienstruktur gekommen, also einer Vermehrung der Familienmitglieder mit ungleicher und einem Schwund derjenigen mit gleicher Generationenzugehörigkeit. Die gemeinsame Lebenszeit der Generationen ist erheblich länger geworden.
Damit kommt den Beziehungen zwischen den erwachsenen Generationen in der Familie eine steigende Bedeutung zu. Entgegen vielen beliebten Verfallsthesen sind sie – wie die Ergebnisse des Alters-Survey zeigen – (noch) weitgehend lebendig und intakt. Zwar ist das Zusammenwohnen der erwachsenen Generationen im selben Haushalt überall in den westlichen Gesellschaften zur Ausnahme geworden. Die typische Wohnform im Alter sind heute Zwei- und Einpersonenhaushalte. Und während von den 40 bis 54-Jährigen, die mindestens ein lebendes Kind haben, 77 Prozent zusammen mit einem Kind im selben Haushalt wohnen, sind es von den 70 bis 85-Jährigen nur noch neun Prozent. Zieht man die Grenzen des „Zusammenwohnens“ jedoch etwas weiter, ergibt sich ein anderes Bild. Mehr als ein Viertel der 70 bis 85-Jährigen lebt mit einem Kind unter einem Dach (im selben Haushalt oder in getrennten Haushalten im selben Haus). 45 Prozent haben mindestens ein Kind in der Nachbarschaft, bei mehr als zwei Dritteln wohnt das nächste Kind zumindest im selben Ort und bei neun Zehnteln nicht weiter als zwei Stunden entfernt. Von einer räumlichen Isolation der älteren Eltern von ihren Kindern kann also nur bei einer Minderheit die Rede sein.
Noch deutlicher sprechen die Befunde über die materiellen Transfers (Geld und größere Sachgeschenke in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung) und andere Unterstützungsformen gegen die oftmals behauptete Tendenz zur Auflösung des familialen Generationenverhältnisses. Wenn die Transferströme innerhalb der Generationenfolge den instrumentellen Hilfeleistungen – gefragt wurde nach Arbeiten im Haushalt, zum Beispiel beim Saubermachen, bei kleineren Reparaturen oder beim Einkaufen – gegenüber gestellt werden, zeigt sich eine deutliche Asymmetrie. Materielle Werte fließen im Wesentlichen von den älteren an die jüngeren Generationen. Transferströme in umgekehrter Richtung sind kaum zu sehen. Jede vierte 70 bis 85-Jährige Person leistet materielle Transfers an mindestens eines ihrer Kinder, jede siebte (auch) an die Enkel. Aber nur drei Prozent erhalten materielle Transfers von den Kindern und praktisch niemand von den Enkeln.
Der Alters-Survey
Im Alters-Survey gibt es eine Fülle interessanter Befunde, von denen einige an dieser Stelle exemplarisch die Forschungsleistungen der FU beleuchten sollen. Das Ziel des Alters-Survey ist eine umfassende Beobachtung des Alternsprozesses der deutschen Bevölkerung. Es geht um die Bereitstellung von Informationsgrundlagen für Politik und gesellschaftliche Selbstverständigung und zugleich um die Bearbeitung der entsprechenden Forschungslücken. Dazu gehören insbesondere die Austauschprozesse zwischen den Generationen sowie die gesellschaftliche Partizipation und „Produktivität“ der älteren Menschen. Der Alters-Survey basiert auf einer großen repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung von 40 bis 85 Jahren. Er konzentriert sich also nicht nur auf das höhere Alter als solches, sondern auf die ganze zweite Lebenshälfte. Die erste Befragungswelle fand 1996 statt, die zweite (die derzeit ausgewertet wird) 2002. Mit dem Alters-Survey können aussagekräftige, gesicherte Ergebnisse zur Verbreitung und Bedingungsstruktur von Lebenslagen und Lebenskonzepten gewonnen werden – auch solcher Dimensionen, die bisher nur mit lokalen oder nicht-repräsentativen Stichproben untersucht worden sind. Zugleich ist die Stichprobe (in der ersten Welle 4.838 Befragte) groß genug, um auch kleinere Bevölkerungsgruppen noch mit Aussicht auf Erfolg analysieren zu können. Beispiele dafür sind diejenigen, die im Alter noch an formaler Bildung (etwa im Rahmen der Universitäten) partizipieren, oder diejenigen, die in alterspezifischen Organisationen oder in selbst organisierten Tätigkeiten engagiert sind. Es handelt sich um interessante Gruppen, die oft viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, aber typischerweise eine so geringe Verbreitung haben, dass sie in konventionellen Repräsentativuntersuchungen kaum zu erfassen sind. |
Der Sozialstaat ist insofern sehr erfolgreich – die erwachsenen Kinder müssen nur in Ausnahmefällen ihre Eltern finanziell unterstützen, und die Älteren können im Gegenteil aus ihren laufenden Einkünften oder ihrem Ersparten den Kindern aushelfen. Auf der anderen Seite erhält gut ein Fünftel der Älteren instrumentelle Unterstützung von den Kindern, während nur knapp sieben Prozent ihre Kinder unterstützen; das Verhältnis zu den Enkelkindern ist ähnlich unausgeglichen. Fassen wir beide Unterstützungsformen zusammen, erweisen sich die Älteren jedoch überwiegend als Geber. Damit ergänzen oder ersetzen sie die sozialstaatliche Sicherung – sie federn Notsituationen ihrer Kinder ab. Sie werden dazu nicht zuletzt durch den Sozialstaat selber befähigt, nämlich durch die Transfers im Rahmen des öffentlichen „Generationenvertrages“. Ein Teil von dessen Zahlungen – nach unseren Berechnungen sind es netto neun Prozent des jährlichen Renten- und Pensionsaufkommens – wird von den Älteren also nicht in den eigenen Konsum gesteckt, sondern von ihnen laufend an ihre Nachkommen weitergereicht. Neben diesen Transfers zu Lebzeiten sind auch die Erbschaften zu berücksichtigen, die in den letzten Jahren stark zugenommen haben.

Der „junge Alte“ zählt sein Geld und trinkt Wein. „Die vier Lebensalter“, Kupferstich von A. Romanet (um 1780) nach Valentin de Boulogne (1591 – 1632).
Man kann natürlich erneut bedauern, dass diejenigen, die ihre Nachkommen auf diese Weise unterstützen, in der Minderheit sind, und darin ein noch unausgeschöpftes Potenzial sehen. Und gewiss sollte man das Generationenverhältnis nicht idealisieren – es ist immer zugleich von Ambivalenzen und manchmal von Konflikten geprägt. Aber die „produktiven“ Leistungen der Älteren sind auch hier beträchtlich. Sie erzeugen Bindungen zwischen den Generationen, auf die eine alternde Gesellschaft nicht verzichten kann. Die gegenwärtige Diskussion über den sozialstaatlichen Generationenvertrag ist einseitig auf dessen Finanzierungsprobleme fixiert und läuft Gefahr, diese notwendigen Bindungen zu vergessen.
Literatur
Freya Dittmann-Kohli, Christina Bode & Gerben J. Westerhof (Hrsg.) (2001): Die zweite Lebenshälfte – Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer.
Martin Kohli & Harald Künemund (Hrsg.) (2000a): Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske + Budrich.
Martin Kohli & Harald Künemund (2000b): Die Grenzen des Alters – Strukturen und Bedeutungen. In: Perrig-Chiello, Pasqualina & François Höpflinger (Hrsg.): Jenseits des Zenits. Frauen und Männer in der zweiten Lebenshälfte. Bern: Haupt, 37 – 60.
Martin Kohli, Harald Künemund, Andreas Motel & Marc Szydlik (2000): Generationenbeziehungen. In: Martin Kohli & Harald Künemund (Hrsg.): Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey. Opladen: Leske + Budrich, 176 – 211.
Harald Künemund (1999): Entpflichtung und Produktivität des Alters. In: WSI-Mitteilungen, 52, 26 – 31.
|
1 Schlussbericht der Enquête-Kommission Demographischer Wandel (2002), S.48.
2 Eine Übersicht über die soziologischen Befunde bietet der Band von Martin Kohli & Harald Künemund (2000a), über die psychologischen derjenige von Freya Dittmann-Kohli, Christina Bode & Gerben J. Westerhof (2001). Der Datensatz der ersten Welle steht für wissenschaftliche Sekundäranalysen im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (Köln) unter der Studien-Nr. 3264 zur Verfügung.
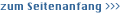
|