|
Foto: Reuters
Auswirkungen traumatischer Erlebnisse nach Attentaten
Interview mit Prof. Dr. Isabella Heuser, Direktorin der Psychiatrischen Klinik der Freien Universität
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Isabella Heuser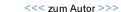
Fundiert: Wird nach dem 11. September nichts mehr so sein wie es war?
Heuser: In den USA werden die Flugzeugattentate die „kollektive Seele“ noch lange bewegen. Dort ist die Verunsicherung groß, da die Amerikaner lange keinen Krieg auf eigenem Boden erlebt haben. Zudem ist die Presseberichterstattung sehr viel ausgeprägter als in Deutschland. Es wird meines Erachtens auch sehr davon abhängen, ob die amerikanische Wirtschaft wirklich eine entscheidende Rezession erlebt. Auf jeden Fall wird sich das für die USA so typische Gefühl des „anything goes“ verändern. Ich denke, man kann den 11. September mit der Erschütterung nach der Ermordung John F. Kennedys vergleichen.
Inwieweit sich in der deutschen kollektiven Seele dauerhaft etwas wandelt, wird davon abhängen, was mit deutschen Soldaten in Afghanistan passiert. In meiner eigenen Welt hat sich „äußerlich“ nicht viel verändert, aber in meinem Lebensgefühl schon. Und es ist doch bezeichnend, dass sich jeder genau daran erinnern kann, was er am 11. September gemacht hat. Der 11. September hat uns emotional bewegt – und schließlich sind es die Gefühle, die uns antreiben.
Fundiert: Was geht in einem Attentäter vor, der ein Flugzeug in das World Trade Center steuert und dabei den eigenen Tod vor Augen hat?
Heuser: Es bleibt für mich die Frage, ob ein in westlichen Traditionen erzogener Mensch nachvollziehen kann, was in einem zutiefst religiösen Menschen vorgeht, der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Die Attentäter vom 11. September haben sich geopfert, ihr Leben fortgeworfen. Das Täterprofil war für uns überraschend. Denn die Attentäter waren gebildete junge Männer Anfang dreißig, die in der westlichen Zivilisation seit mindestens acht Jahren gelebt und sie kennen gelernt haben. Dennoch haben sie sich nicht von der in unseren Augen „guten“ Lebensweise infizieren lassen. Vielmehr scheinen sie ihre eigene tiefe, wenngleich fehlgeleitete religiöse Überzeugung über alle westlichen Einflüsse gestellt zu haben. Der gefundene Brief des Attentäters Atta weist aber auch eine sehr starke narzistische Komponente auf. Die Attentäter wollten wohl – wie andere Märtyer auch – durch ihr Verhalten „gott-gleich“ bzw. „allah-ähnlich“ werden!
Fundiert: Sind Selbstmordattentäter psychisch krank oder religiös fanatisch?
Heuser: Religiös fanatisch sind sie sicher, aber ich wehre mich dagegen, alles Unverständliche und Schreckliche zu pathologisieren. Das wäre viel zu einfach. Fanatismus fällt nicht unter die Definition der Weltgesundheitsorganisation für psychische Erkrankungen und wir sollten uns davor hüten, das Verhalten der Selbstmordattentäter zu psycho-phatologisieren.
Fundiert: Kann eine Gesellschaft sich auf terroristische Attacken vorbereiten?
Heuser: Ich denke eine Gesellschaft kann auf so etwas nicht eingerichtet sein. Sehen Sie sich doch nur den Skandal um den angeblichen Milzbrandbrief in Deutschland an, der neun Tage irgendwo lagerte. Auf eine Bio-Attacke können Sie sich nicht vorbereiten. Auch die Amerikaner waren dagegen nicht gerüstet. Wir kannten bislang ja keine terroristischen Flugzeug- oder Bioattacken.
Fundiert: Merken Sie bei Ihren Patienten, dass sich die Verunsicherung durch die Attentate und die Milzbrandbriefe auswirkt?
Heuser: Bei psychiatrischen Patienten, die eine Wahnerkrankung haben, ist es grundsätzlich so, dass sich der Wahn im sozio-kulturellen Umfeld des Patienten „entwickelt“. Das beschrieben schon Ärzte im Altertum und im Mittelalter. Nach dem Fall der Mauer entwickelten viele Patienten eine Angst vor der Stasi. Ende der achtziger Jahre, auf dem Höhepunkt der AIDS-Angst, beobachteten Psychiater auf der ganzen Welt einen Aids-Wahn. In meiner zwanzigjährigen psychiatrischen Tätigkeit habe ich aber bisher noch keinen Patienten gehabt, der Angst vor einer Bakterienverseuchung des Trinkwassers hatte und sich deshalb brieflich an Regierungsstellen gewandt hat. In der letzten Zeit hatte ich immerhin zwei derartige Fälle. Nach dem 11. September haben wir in der Klinik am Abend und am nächsten Tag in „Patientenrunden“ darüber gesprochen. Das ist bei psychiatrischen Patienten nötig, die oft unter Ängsten leiden.
Fundiert: Unter welchen Störungen können Hinterbliebene von Terrorattacken leiden?
Heuser: Mit Hinterbliebenen in New York habe ich natürlich nicht selbst gesprochen. Eine New Yorker Kollegin berichtete mir aber, dass viele Augenzeugen Symptome einer posttraumatischen Störung haben. Zunächst wollen die Menschen das Passierte nicht wahrhaben, können sich auf nichts mehr konzentrieren und laufen ziellos in der Gegend herum. Dieser Zustand dauert in der Regel mehrere Stunden bis Tage, wir nennen es „akutes Stress-Syndrom“. Dann kommt die Phase der intensiven, fast zwanghaften Verleugnung. In Interviews erzählten Hinterbliebene, sie würden spüren, dass ihr Mann, Freund oder Frau noch lebt. Das ist eine fokussierte Bewusstseins-Einengung. Im Gespräch mit professionellen Helfern werden die Hinterbliebenen an die Realität herangeführt. Dann setzt die Trauerarbeit ein, der Umgang damit, dass der geliebte Mensch nicht mehr ist. Ich finde, dass der New Yorker Bürgermeister Guliani, der von Psychiatern beraten wurde, hervorragend reagiert hat. Nach drei Wochen wies er die Feuerwehrleute an, mit schweren Geräten die Aufräumarbeiten fortzusetzen und an den Wiederaufbau zu denken. Damit hat er das Verleugnen der Feuerwehrleute beendet. Er hat gewissermaßen von oben den scheinbar grausamen Schritt „nach vorne“ verordnet. Für die New Yorker Hinterbliebenen ist es natürlich besonders schlimm, da sie ihre Verstorbenen nicht richtig beerdigen können, nicht die so wichtigen, da trösenden Rituale des Abschiednehmens durchleben können.
Fundiert: Wie kann man helfen?
Heuser: Manche Augenzeugen und Hinterbliebene, aber besonders viele Helfer leiden unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. In der psychiatrischen Klinik der Freien Universität sind wir auf Stress-Syndrome, z. B. Angststörungen, Depressionen und eben auch Posttraumatische Belastungsstörungen, spezialisiert. Meiner Erfahrung nach braucht jeder, der ein traumatisches Erlebnis durchlitten hat, präventiv sofort eine so genannte Kurzintervention. Dabei verstehen wir unter Trauma ein Erlebnis potentiell tödlicher Bedrohung oder aber zu beobachten, wie jemand unerwartet oder auf grässliche Weise zu Tode kommt beziehungsweise erheblich bedroht wird. Menschen, denen so etwas passiert, haben ein hohes Risiko, eine Posttraumatische Belastungstörung zu entwickeln. Denken Sie nur an die Überlebenden des Bahnunglücks von Eschede oder, vor ca. 10 Jahren, die Flugzeugkatastrophe von Rammstein.
Fundiert: Wie sieht eine Kurzintervention aus?
Heuser: In meiner Abteilung sind wir derzeit mit dem Erstellen eines so genannten Manuals für Kurzinterventionen beschäftigt, das wir gemeinsam mit der Kriseninterventions-Station des UKBF und S.I.G.NA.L. entwickeln. Damit wollen wir beispielsweise vergewaltigten Frauen oder U-Bahnfahrern, die einen Menschen überfahren haben, helfen. Eine Kurzintervention dauert in der Regel vier Stunden. Zwei Stunden wird dabei Psycho-Edukation betrieben. Das heißt, wir erklären dem Klienten genau, was körperlich und seelisch nach einem Trauma mit ihm passiert. In der Regel können die Menschen schlecht schlafen, sich nicht konzentrieren und nicht denken. Kurz nach dem Trauma ist es wenig sinnvoll, den Klienten über das Erlebnis sofort erzählen zu lassen. Erst in der dritten und vierten Stunde sollte über das Geschehene gesprochen werden.
Fundiert: Was passiert mit traumatisierten Menschen, die keine Kurzintervention erhalten?
Heuser: Rund 20 bis 25 Prozent entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) – das ist ein hoher Prozentsatz. Die Belastungsstörung setzt nach sechs bis acht Wochen oder aber erst nach einem halben Jahr ein. Die Patienten sind schlechter Stimmung, das heißt sie sind verzweifelt oder niedergeschlagen und empfinden ein Gefühl der inneren Leere. Außerdem kommt es zu ausgeprägten Schlafstörungen, Schweißausbrüchen, Herzklopfen und Ängsten. Die Patienten können sich gegen so genannte gedankliche Intrusionen nicht wehren und gehen in Gedanken immer wieder das schreckliche Erlebnis durch, vor allem wenn sie sich in einer ruhigen Situation befinden. In der neuro-biologischen Forschung gehen wir von einem hypermnestischen Zustand aus, bei dem man sich besonders gut an das Geschehene erinnert. Die Patienten können sich bis in das kleinste Detail an das schreckliche Erleben erinnern, das wissen wir gut von den Hinterbliebenen von Rammstein. Das ständige Sich-Erinnern-Müssen ist furchtbar quälend. Einige ertränken ihren Kummer dann in Alkohol. Es passiert nicht selten, dass Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung von Alkohol oder Beruhigungsmitteln abhängig werden.
Für die Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung gibt es inzwischen gute Richtlinien. Zum einen werden Patienten mit Medikamenten zum anderen mit einer Verhaltenstherapie behandelt. Die Patienten werden in der Regel sechs Wochen stationär aufgenommen, denn einige müssen von den Benzozeptinen und dem Alkohol langsam entwöhnt werden. Dann erfolgt eine ambulante Therapie. Die Behandlung dauert in der Regel sechs Monate, die Heilungschancen sind gut.
Fundiert: Was geht in den Trittbrettfahrern vor, was wollen sie erreichen?
Heuser: Trittbrettfahrer sind Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung. Die meisten haben bislang ein wenig erfolgreiches Leben gelebt und sind nach dem gängigen gesellschaftlichen Wertesystem am unteren Ende. Diese Menschen sehen keine andere Möglichkeit beachtet zu werden, als durch eine solche Tat. Sie wollen, dass Chaos ausbricht. Durch eine einzelne Aktion wollen sie Millionen beeindrucken.
Fundiert: Wie soll man mit Trittbrettfahrern verfahren?
Heuser: Bei allem „Verständnis“, Trittbrettfahrer müssen bestraft werden, denn sie sind in aller Regel nicht im forensischen Sinne „schuldunfähig“, sie können durchaus das Unrecht ihrer Tat einsehen! Trittbrettfahrer bedürfen aber auch der psychotherapeutischen Hilfe. Die Therapie von Persönlichkeitsstörungen dauert in der Regel lange und gestaltet sich schwierig.
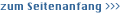
|