| Foto: Ausserhofer
Wie Kinder sprechen lernen
Spracherwerb zwischen Kinderkram und Menschheitsrätsel
Prof. Dr. Gisela Klann-Delius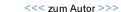
Die Fähigkeit sprechen zu können erscheint den Allermeisten als völlig normal. Wie aber gelangen wir zu dieser Fähigkeit? Wann lernen wir, aus den ersten Lauten ganze Wörter und später ganze Sätze zu bilden? Ist diese Fähigkeit angeboren oder müssen wir sie uns aneignen? Die Kindersprachforschung hat sich diesen Fragen genähert und bietet spannende Antworten an. Ganz gelöst scheint diese Frage jedoch noch nicht. Die Professorin für Psycholinguistik am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität, Prof. Dr. Gisela Klann-Delius, gibt uns einen Einblick in den Stand der Forschung.
In aller Regel lernen Neugeborene die Sprache ihrer Umgebung. Egal in welcher Gemeinschaft ein Kind aufwächst, es lernt in dem überschaubaren Zeitraum von ungefähr fünf Jahren genau die Sprache, die es täglich hört. Dabei gehen Kinder ziemlich systematisch vor: Vom ersten Schrei zum ersten Laut, vom Wort bis hin zu ganzen Sätzen. Gewiss gibt es auch dabei Unterschiede, aber die Variabilität reicht nie so weit, dass Kinder von Beginn an in komplexen Sätzen reden oder dass es zwanzig Jahre dauert, bis ein vollständiger Satz gesprochen werden kann.
Schon immer zeigten sich Menschen daran interessiert, das Wesen der Sprache zu ergründen. Ein frühes Motiv war, sich des Wesens menschlicher Erkenntnis des Natürlichen wie Göttlichen zu vergewissern, ein späteres eine vermutete Ursprache ausfindig zu machen. Ein wichtiges Motiv der Neuzeit ist, in der Sprache den Rubikon zwischen Menschen und ihren äffischen Anverwandten zu sichern. Trotz unterschiedlicher Motivlage des Denkens und Philosophierens über Sprache lässt sich als Grundannahme festhalten, dass Sprache Indiz und Mitteilungsmedium des Denkens ist, dass durch sie die Wahrnehmungen der Welt und die Erfahrungen in ihr für andere nachvollziehbar dargestellt werden und gestaltbar sind.
Nach allem, was wir heute über die Sprachfähigkeit und Sprachfertigkeit der Affen wissen, ist sie mit der des Menschen kaum vergleichbar. Wie kommt es also, dass ein Kind, anders als ein Affe, in einer recht kurzen Zeit sprechen lernt?
Die Kindersprachforschung hat diese Frage in den Mittelpunkt gestellt. Sie betrachtet Spracherwerb als via regia zum Verständnis von Sprache und menschlichem Geist (Stern/Stern 1928/1965) und hat auf die Frage nach den Entwicklungsbedingungen und -mechanismen des kindlichen Spracherwerbs eine Fülle von Erklärungsvorschlägen hervorgebracht.
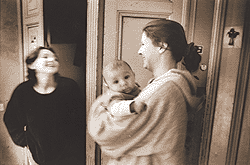
Foto: Ausserhofer
Ein naheliegender Vorschlag ist, eine humanspezifische Sprachfähigkeit für den Sprachwortschatz des Kindes verantwortlich zu machen. Dieser Vorschlag ist nicht ganz so offensichtlich wie man dies meinen möchte. Denn nach behavioristischer Position (z.B. Watson 1930; Skinner 1957), werden Kinder nach dem Reiz-Reaktionsprinzip, gekoppelt mit Belohnung/Bestrafung, ebenso auf Sprache trainiert wie der berühmte Pawlowsche Hund, der auf einen Glockenton als sicheres Indiz für herannahendes Futter konditioniert wurde und sich in Vorfreude die Lefzen besabberte. Das „behavioristische Baby“ kommt zur Sprache ganz ohne genetisch vorgegebene Sprachfähigkeit. Es genügt, dass die Eltern häufig genug ihren Kindern Wörter und Sätze vorsprechen und die sprachlichen Äußerungen mit guten Gaben belohnen. Ein Glockenton als Anzeichen für Futtergabe und eine sprachliche Äußerung als Ausdruck von Bedeutungen lassen sich aber offenkundig nicht parallelisieren. Sprache ist etwas komplizierter konstruiert, wie der Linguist Noam Chomsky in seiner fundamentalen Kritik an Skinner mit viel Witz nachgewiesen hat (Chomsky 1959). Dies ist jedoch eine akademische Replik, die gewiss an behavioristischer Spitzfindigkeit hätte scheitern können, hätten die Kinder sich nicht völlig unbotmäßig gegen die postulierte Theorie benommen. „Der Kasperl gehte zum Wolf“ etwa ist eine für einen Dreijährigen völlig unverfängliche Antwort auf die Frage, wie denn das Kasperle-Theater war und was der Kasperl gemacht habe. Noch kleinere Kinder zeigen häufig Adaptierung von Wörtern an ihre Aussprachemöglichkeiten, sie ersetzen zum Beispiel ein innervokalisches „s“ durch ein „h“. Heiter sprechen diese Kleinen von „waha“, wenn sie ganz offenkundig „Wasser“ meinen. Selbst tausendfache Korrekturen oder besonders genaues Vorsprechen helfen nichts, von Smarties oder anderen Belohnungen ganz zu schweigen. Irgendwann ist das Kind dann von selbst bereit, von „Wasser“ statt „waha“ zu sprechen.
Wenn es nun bei der Sprache ebenso einen Reifungszeitpunkt gibt wie für Krabbeln oder Laufen, warum die Erklärung nicht in einem angeborenen Reifungsplan und einem angeborenen Wissen um Sprache suchen? Noam Chomsky hat in der Tat vorgeschlagen, den kindlichen Spracherwerb als einen genetisch programmierten Reifungsvorgang zu betrachten: Die Sprache bildet sich heraus, genauso wie die Körperorgane wachsen. Demnach wird Sprache nicht gelernt. Das Kind hat, so Chomsky, ein angeborenes Wissen um die in allen Sprachen gegebenen Strukturen (Prinzipien) zusammen mit den in den natürlichen Einzelsprachen genutzten Ausprägungen dieser allgemeinen Strukturen (Parameter; Chomsky 1986). Dieses sprachliche Wissen wird von der Umgebungssprache, die das Kind hört, ausgelöst; dabei entdeckt das Kind, welche der möglichen Strukturen für seine Umgebungssprache gültig sind. Hört ein Kind häufig Formen wie „le ballon grand“ oder „le chat gris“, entdeckt es, dass es die Position des Adjektivs rechts vom Nomen zu vergeben hat; hört es dagegen seine Eltern sagen: „schau, der rote Ballon“, „da ist sie, die graue Katze“, so wird es die Position links vom Nomen als die korrekte besetzen. Auf Grund seines angeborenen Wissens weiß das Kind, dass ein Adjektiv in der Regel entweder rechts oder links vom Nomen steht, die Umgebungssprache zeigt dem Kind, welche der beiden Optionen in seiner Muttersprache zutreffend sind. Das Kind lernt keine Sprache, es entdeckt sie als ein in ihm schon vorhandenes latentes Wissen. Dieses Entdecken erfordert keine besondere Intelligenz oder gar soziale Förderung. Nach Chomsky ist Sprache eine besondere, von allgemeiner Intelligenz oder sozialer Einflussnahme unabhängige Fähigkeit des Menschen.
In der Tat ließen sich für diese Position einige Evidenzen finden, vor allem aus dem Bereich der Sprachentwicklungspathologie. So sind Kinder beziehungsweise Jugendliche bekannt, deren Intelligenzquotient extrem niedrig ist, die aber trotzdem ihre Muttersprache zu beherrschen gelernt haben. Ein Beispiel ist Christopher. Auch er ein Kind von sehr geringer Intelligenz, das trotzdem nicht nur Englisch perfekt lernte, sondern darüber hinaus eine Vielzahl anderer, vom Englischen häufig strukturell sehr verschiedene Sprachen erwarb (Smith/Tsimply 1995). Ebenfalls eindrucksvoll sind Kinder mit dem genetisch bedingten Williams-Syndrom, die – wiederum bei sehr geringer allgemeiner Intelligenz – erstaunliche Sprachfähigkeiten erlangen (Bellugi et al. 1994) und ungewöhnlich lebhafte, auf den Zuhörer zugeschnittene Erzählungen produzieren können (Reilly et al. 1990). Auch der Entwicklungsverlauf von Kindern mit Down-Syndrom scheint eine Unabhängigkeit der sprachlichen von der kognitiven Entwicklung zu bestätigen (Chapman 1995). Trotz dieser auf den ersten Blick eindrucksvollen Befunde ist der Erklärungsvorschlag von Chomsky und seinen Schülern (z.B. Steven Pinker; vgl. Pinker 1994) umstritten (vgl. Elman et al. 1996). Kritische Stimmen kommen nicht nur aus der Sprachwissenschaft (z.B. Haider 1991) und psycholinguistischen Spracherwerbsforschung (z.B. Bates/MacWhinney 1987; Karmiloff-Smith 1995), sondern auch aus der Psychologie und Entwicklungspsychologie (Nelson 1996; Grimm 1998) sowie der Biologie (Studdert-Kennedy 1991). Die Frage des Spracherwerbs umstandslos auf genetische Sprachprogramme zu reduzieren, ohne für sie direkte Evidenzen bringen zu können, Spracherwerb völlig von der kognitiven und sozialen Entwicklung loszulösen, Spracherwerb primär auf den Syntaxerwerb zu beziehen, all dies sind kritische Einwände.

Foto: Ausserhofer
Bis in die neunziger Jahre wurde das von dem Biologen, Epistemologen und Psychologen Jean Piaget in einer Vielzahl von Beobachtungsstudien präzisierte Modell der kindlichen Entwicklung als das ernstzunehmende Gegenprogramm zu einem Nativismus Chomskyscher Prägung weithin akzeptiert. Die Grundthese Piagets ist, dass die Entwicklung des kindlichen Denkens und der Sprache, die er vorwiegend als Ausdrucksmittel des Denkens betrachtet (Piaget/Inhelder 1977), auf wenigen, unspezifischen genetischen Vorgaben beruht und sich durch Anpassungs- und Austauschprozesse des Kindes mit seiner Umgebung herausbildet (Piaget 1973). Intelligenz verdankt sich demnach aktiver Bewältigung der Umwelt durch das Kind, in der sich das Kind die Gegebenheiten der Umwelt nach seinen Maßgaben aneignet (Assimilation) und sich dabei zugleich diesen Gegebenheiten anpasst (Akkomodation; vgl. Piaget 1972). Das Denken ist in diesem Modell die notwendige Voraussetzung des Spracherwerbs und Sprache wird in dem Maße weiter ausdifferenziert, wie die kognitiven Entwicklungsprozesse voranschreiten. Ist ein Kind im Denken noch nicht so weit, dass es seine eigene Perspektive von der eines anderen zuverlässig unterscheiden kann, zeigt sich dies in einer egozentrischen Sprechweise. So werden Personal- und Demonstrativpronomina in einer Weise verwendet, dass dem Gesprächspartner deren Bezug nicht erschließbar ist. Eine Bildsequenz, in der zu sehen ist, wie zunächst ein Mädchen auf einen Baum klettert und ihr dann eine Katze folgt, würden Kinder in egozentrischen Stadien beschreiben als „sie klettert rauf und sie klettert auch rauf“. Da auch die Welterkenntnis des egozentrischen Kindes nach globalen Kriterien organisiert ist, zum Beispiel alles, was sich bewegt, als lebendig betrachtet wird, sind dies auch die kindlichen Sprachäußerungen. Da der Spracherwerbsprozess primär von der Intelligenzentwicklung abhängig gedacht ist und diese durch die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit der Welt der Dinge geformt wird, kommt der sozialen Vermittlung des Spracherwerbs in diesem Konzept keine herausgehobene Bedeutung zu. Piaget trifft keine Unterscheidung zwischen der Welt der Dinge und der Welt der Personen (Piaget 1972).
Piagets Model enthält, ebenso wie das von Chomsky, Vereinseitigungen: Die sozialen Momente von kindlicher Entwicklung und Spracherwerb werden nicht als wichtig erachtet. Dies ist einer der kritischen Einwände gegen Piagets Konzept. Außerdem wurden wesentliche Grundaussagen dieses Konzeptes durch Ergebnisse der neueren Forschung in Zweifel gezogen. So konnte gezeigt werden, dass bereits Neugeborene sehr viel mehr Kompetenzen besitzen, als Piaget annahm. Es wurde in Frage gestellt, ob Entwicklungsprozesse im Sinne eines zunehmenden, in allen Entwicklungsbereichen synchron verlaufenden Fortschrittes gedeutet werden können; vor allem aber wurde bezweifelt, dass die kognitive Entwicklung einen zureichenden Erklärungsrahmen für die sprachliche abgibt. Zum einen ist Sprache nämlich als ein Erkenntnisobjekt besonderer Art anzuerkennen (Karmiloff-Smith 1979), zum anderen lassen sich, wenn überhaupt, nur spezifische Beziehungen zwischen kognitiven und sprachlichen Teilfähigkeiten empirisch nachweisen (Gopnik/ Meltzoff 1987). Die kognitive Entwicklung lässt sich somit nicht als notwendige und hinreichende Bedingung des Spracherwerbs konzipieren und empirisch bestätigen (Cromer 1974).
In einem dritten Vorschlag zur Klärung des Rätsels Spracherwerb wird eine deutlich weitere Perspektive eingenommen: Sowohl genetische Prädispositionen als auch kognitive und soziale Prozesse werden als Faktoren anerkannt, die in einem komplexen Wechselspiel den Spracherwerb regulieren. Was genetische Prädispositionen zum Spracherwerb angeht, wird in diesem Vorschlag weniger auf sprachliches Wissen als viel mehr auf die genetische Disposition zur Kommunikation abgehoben. Eine Vielzahl empirischer Studien konnte zeigen, dass Neugeborene und Säuglinge bemerkenswerte Fähigkeiten besitzen: Sie verfügen über mimische Ausdrucksmuster für die meisten grundlegenden Emotionen wie Schmerz oder Trauer (Izard/Malatesta 1987). Ihre visuelle Wahrnehmung – zunächst nur in einer Distanz von ca. 20 cm scharfsichtig – erlaubt Farben-, Kontrast- und Mustererkennung. Das zum Beispiel visuell Wahrgenommene kann mit Wahrnehmungen in einer anderen Modalität korreliert werden (amodale Wahrnehmung), auditive und visuelle Wahrnehmungen werden aufeinander bezogen. Dies ermöglicht dem Säugling, Invarianzen und Äquivalenzen in den Sinneseindrücken zu erkennen. Demnach lebt selbst das Neugeborene nicht, wie man früher annahm, in einer „blooming-buzzing confusion“ (Mehler 1985). Hinzu kommt, dass Neugeborene und Säuglinge Lernbereitschaft und -fähigkeit von Anfang an haben. Schon mit drei Monaten zeigen sie Zeigegesten ähnliche Handbewegungen, die sich ab dem neunten Monat zu regulären Zeigegesten fortentwickeln. Außerdem haben Säuglinge eine besondere Vorliebe für das menschliche Gesicht und die menschliche Stimme, die sie zuverlässig von anderen Lauten unterscheiden können. Mehr noch: Sie können nicht nur die menschliche Stimme, sondern auch die ihrer Mutter von anderen unterscheiden und Texte, die sie im Mutterleib wahrgenommen haben, nach der Geburt (vermutlich an deren Klanggestalt) wiedererkennen (DeCasper/Fifer 1980; DeCasper/Spence 1986). Zudem bevorzugen bereits Neugeborene die sogenannte Ammensprache gegenüber einer Erwachsenensprechweise (Cooper/Aslin 1990).

Foto: Ausserhofer
Die Erkennungsleistungen von Neugeborenen und Säuglingen finden ihrerseits eine Entsprechung im Verhalten der Eltern: Eltern zeigen gegenüber Säuglingen ein überdeutliches Minenspiel und bieten dieses häufig in der Distanz dar, in der der Säugling scharf sehen kann. Allem voran aber sprechen Eltern mit dem Säugling in besonderer Weise: Sie nutzen eine deutliche Betonung, klare Modulation, markante Pausen, Vereinfachung und Verdeutlichung der Ausdrucksweise. Damit antworten sie auf die anfängliche Sensibilität des Säuglings für Tonhöhe, Tondauer, Prosodie und Pausen. Auch im späteren Entwicklungsverlauf passen sich die Eltern den Verarbeitungsmöglichkeiten des Kindes an. Beginnen die Kinder mit den ersten Zusammenfügungen von Wörtern zu Sätzen, beginnen sie die ersten grammatischen Markierungen an den Wörtern vorzunehmen, so antworten Eltern ihren Kindern oft in Äußerungen, die das vom Kind Gesagte in grammatisch korrekter oder erweiterter Form wiederholen. Eltern trainieren ihre Kinder nicht, sie zeigen ihnen aber sehr wohl wie Sprache funktioniert, wobei sie die Sprachmodelle immer in den lebendigen Dialog mit dem Kind auf ganz natürliche Weise einbinden. Hierbei verfahren Eltern in der Regel bemerkenswert diskret. Schaut etwa ein Vater mit seinem Kind ein Bilderbuch an, in dem Elefanten abgebildet sind, deutet das Kind auf einen Elefanten und sagt „Maus“, so antwortet er in der Regel nicht „Nein, das ist doch ein Elefant“, sondern „Tja, sieht irgendwie fast so aus wie eine Maus. Das ist aber ein Elefant, schau mal, der hat ganz große Ohren und einen langen, langen Rüssel“. Diese besondere elterliche Sprechweise (häufig motherese oder Ammensprache genannt), die ein Element der intuitiven elterlichen Verhaltensanpassung beziehungsweise Didaktik ist, konnte bislang nur zum Teil in anderen als den üblicherweise untersuchten westlichen Kulturen nachgewiesen werden. Außerdem konnte bislang nicht gezeigt werden, dass diese Sprechweise einen unmittelbaren Einfluss auf den Spracherwerb hat: Auch Kinder, die dieser kommunikativen Feinabstimmung nicht teilhaftig werden, lernen ihre Muttersprache. Gänzlich unerheblich aber dürften die elterlichen Verhaltensanpassung doch nicht sein, denn diese sind überlebensnotwendig für den Säugling, der als hilfloses Wesen auf die Pflege und den Schutz der Eltern und das von ihnen auch stimmlich vermittelte sogenannte Kontaktbehagen angewiesen ist (Grossmann et al. 1989).
Eine grundlegende These interaktionistischer Entwicklungsmodelle ist, dass im Zusammenspiel zwischen kindlichen Kompetenzen und elterlicher Reaktion die im Kind angelegten Teilfähigkeiten befestigt, weiter ausdifferenziert und miteinander integriert werden (Thelen/Smith 1994). Der Spracherwerb beginnt, so die Annahme dieser Modelle, lange bevor Sprache ersichtlich wird. Schon in den noch vorsprachlichen Austauschprozessen zwischen Eltern und Kind werden grundlegende Einsichten in und Fähigkeiten zur Kommunikation angebahnt. Indem das Kind ein zunehmend kompetenterer Kommunikationspartner wird, wird es von den Eltern in die sprachlich vermittelte Kommunikation gleichsam spielerisch eingeführt. Hier wird dem Kind gezeigt, wie Sprache als Mittel des Ausdrucks eigener Intentionen, der Übermittlung von Gedanken und als Verfahren, etwas zu erreichen, regelhaft genutzt werden kann. Sprache wird so als wirksames Instrument des sozialen, emotionalen und kognitiven Austauschs zugänglich, was im Kind die Bereitschaft entstehen lässt, sich auch den Reichtum konventioneller Formen und Regeln von Sprache zu erschließen. Hierbei kommen ihm seine kognitiven Fähigkeiten und seine Spracherkennungsfähigkeiten zu Gute, die sich im Zuge der auch neuronalen Entwicklung und Ausdifferenzierung in Abhängigkeit von wiederkehrenden Reizmustern weiter herausgebildet haben (Bates et al. 1994).
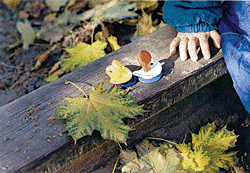
Foto: Ausserhofer
Auch dieser Vorschlag, den kindlichen Spracherwerb zu erklären, ist nicht unumstritten, wiewohl er den Gegebenheiten kindlicher Entwicklungsprozesse weit mehr zu entsprechen scheint als das von Chomsky vorgelegte Konzept. Der kindliche Spracherwerb scheint demnach noch immer ein ungelöstes Rätsel zu sein. Gleichwohl ist festzustellen, dass die bisherige Spracherwerbsforschung einige bedeutende Schritte auf dem Wege zur Lösung des Rätsels getan hat: Der Spracherwerbsverlauf ist zumindest für einige Sprachen gut dokumentiert. Außerdem wurden aus den Erklärungsvorschlägen eine Vielzahl von Voraussagen und Erwartungen abgeleitet, die empirisch überprüft wurden und zu Modifikationen der Erklärungskonzepte führten (Klann-Delius 1999). Das Verständnis für den kindlichen Spracherwerb und die ihn bestimmenden Faktoren wird sich so zunehmend erweitern. Dies ist insofern wichtig, als ein besseres Verständnis der Prozesse des kindlichen Spracherwerbs auch zu einem besseren Verständnis des Erwerbs weiterer Sprachen als der Muttersprache beiträgt; aber auch Diagnose und Therapie von Sprachentwicklungsauffälligkeiten oder -störungen profitieren von einer Kenntnis des Erstspracherwerbs. Nicht zuletzt kann die Kenntnis des kindlichen Spracherwerbs die mit dem Schuleintritt beginnende Unterrichtung im Lesen und Schreiben bereichern.

Foto: Ausserhofer
Literaturverzeichnis
Chomsky, Noam 1986. Knowledge of Language. It’s Nature, Origin and Use. New York etc.
Grossmann, Klaus E.; August, Petra; Fremmer-Bombik, Elisabeth; Friedl, Anton: Grossmann, Karin, Scheuerer-Englisch, Herrmann; Spangler, Gottfried; Stephan, Christine; Suess, Gerhard 1989. Die Bildungstheorie: Modell und enwicklungspsychologische Forschung. In: Heidi Keller (Hg.): Handbuch der Kleinkindforschung. Berlin etc., S. 31-55.
Karmiloff-Smith, Annette 1995. Beyond Modularity. A Developement Perspective on Cognitive Science. Cambridge, MA. London.
Nelson, Katherine 1996. Language in Cognitive Developement. Emergence of the Mediated Mind. Cambridge, MA.
Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel 1977. Die Psychologie des Kindes. Frankfurt/Main (La Psychologie de l’Enfant. Paris 1966)
Klann-Delius, Gisela 1999. Spracherwerb. Stuttgart, Weimar.
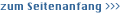
|